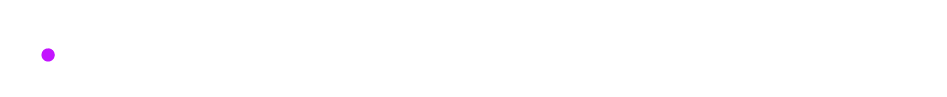Die folgenden Texte sind die zusammengefassten Dokumentationen des GOTTDIGITAL Barcamp 2026 vom 21. Februar 2026. Wir danken noch einmal ganz herzlich allen Freiwilligen, welche die Sessions dokumentiert haben, damit dies möglich ist!
Mit 115 Anmeldungen war das Barcamp nicht nur gut besucht, sondern auch thematisch bemerkenswert vielfältig. Wie es sich für ein echtes Barcamp gehört, wurden die Sessions nicht im Vorfeld zentral geplant, sondern von den Teilnehmenden selbst eingebracht, vorgestellt und angeboten. Das Programm entstand somit aus der Expertise, den Fragen und den Erfahrungen der Community – spontan, praxisnah und diskussionsoffen.
Die Beschreibung des Barcamps findet ihr in diesem Blog-Beitrag.
Die hier veröffentlichten Zusammenfassungen basieren auf den Mitschriften direkt aus den jeweiligen Sessions. Sie spiegeln die Inhalte, Diskussionslinien, Praxisbeispiele und offenen Fragen wider, die vor Ort bewegt wurden.
Um die Dokumentation lesbar und strukturiert aufzubereiten, wurden die Mitschriften im Anschluss mithilfe von Künstlicher Intelligenz zusammengeführt, sprachlich verdichtet und in Prosaform ausgearbeitet. Die inhaltliche Grundlage bleibt dabei die Diskussion der Teilnehmenden – die KI diente ausschließlich der redaktionellen Strukturierung und Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis der Sessions
- Wo kann uns KI in der Medientechnik helfen – Jan Clever
- Kommunikation und Organisation in großen Kirchengemeinden digital gestalten – Lutz Neumeier
- Predigtvorbereitung mit KI (Textanalyse, Exegese) live ausprobieren – Dirk Bruelheide
- Der digitale Schaukasten mit Rasperry PI und KI – Innovation mit 150 Euro Budget – Lutz Neumeier
- Wie können wir KI nutzen, um als Gemeinde/Kirche aus dem Kreisen um uns selbst rauszukommen? – Dr. Jörg Dechert
- Kirche im Social Web: Einblicke in die Fedikirche auf Mastodon – Thomas Ebinger, Alexander Müller, Jörg Sorge
- Gott spielen in Virtual Reality – Dr. Karsten Kopjar
- Welche Leitplanken braucht christliche Digitalisierung im Familienkontext – Robin Zimmermann
Wo kann uns KI in der Medientechnik helfen – Jan Clever
Die Session „Wo kann uns KI in der Medientechnik in Kirchen helfen?“ war eine der praxisorientiertesten Diskussionen des Barcamps. Hier ging es nicht um Zukunftsvisionen, sondern um ganz konkrete Herausforderungen, die viele Gemeinden kennen: zu wenig Personal, begrenztes Budget, steigende Qualitätsansprüche – und eine technische Komplexität, die Ehrenamtliche schnell überfordert.
Jan Clever, der seit 2022 Organisationen und Gemeinden im Bereich Medientechnik berät, eröffnete die Runde mit einer nüchternen Bestandsaufnahme: Medientechnik ist längst kein „Add-on“ mehr. Sie ist integraler Bestandteil von Gottesdiensten, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Aber sie ist auch ein Bereich, der stark von Einzelpersonen abhängt – und genau das macht ihn fragil.
Viele Gemeinden haben:
-
Tonanlagen
-
Mischpulte
-
Beamer
-
Livestream-Setups
-
Lichtsteuerung
Was oft fehlt, sind:
-
konstante Teams
-
technische Ausbildung
-
Übergabestrukturen
-
Zeit für Nachbearbeitung
Ein Beispiel aus der Diskussion: Das Mischpult ist analog, wird von verschiedenen Personen genutzt – jede Woche muss neu eingestellt werden. Niemand speichert Presets, niemand dokumentiert. Das funktioniert – aber es ist ineffizient und fehleranfällig.
Hier setzt KI an – nicht als „magische Lösung“, sondern als Entlastungswerkzeug.
Bevor es um KI im engeren Sinn ging, wurde deutlich: Oft ist bereits klassische Automatisierung ein großer Hebel.
Ein Beispiel: Wenn Gottesdienst-Ablaufpläne digital vorliegen, könnten daraus automatisiert OpenSong-Sets erstellt werden. Statt Lieder manuell zu übertragen, übernimmt das System die Struktur. Das ist noch keine „intelligente KI“, sondern smarte Prozessautomatisierung – aber sie spart Zeit und reduziert Fehler.
Die Session machte klar: Nicht jede Innovation muss sofort künstlich intelligent sein. Manchmal reicht konsequente Digitalisierung.
Ein besonders konkretes Feld war die Weiterverwertung von Livestreams.
Viele Gemeinden streamen ihre Gottesdienste auf YouTube. Doch danach passiert oft wenig. Der Livestream bleibt als Ganzes online – aber einzelne Highlights werden nicht weiterverwendet.
Hier wurden Tools wie OpusClip ins Spiel gebracht – KI-gestützte Software, die:
-
lange Videos analysiert
-
zentrale Momente erkennt
-
automatisch kurze Clips erstellt
-
Formate für Instagram, YouTube Shorts oder TikTok generiert
Das Potenzial ist enorm: Aus einem 90-minütigen Gottesdienst entstehen mehrere 30–60-Sekunden-Clips.
So wird aus einem einmaligen Ereignis eine Woche Social-Media-Präsenz – ohne dass ein Ehrenamtlicher stundenlang schneiden muss. Die Diskussion war pragmatisch: KI spart hier nicht nur Zeit, sie erhöht auch Reichweite.
Ein spannender Teil der Session war die Frage: Kann KI beim Mischen helfen – oder sogar „selbst mischen“?
Zwar sind viele kirchliche Setups noch analog geprägt, doch es gibt bereits Plugins und Softwarelösungen, die mit intelligenten Algorithmen arbeiten.
Genannt wurden beispielsweise:
-
Plugins von Waves (https://www.waves.com/)
-
LiveProfessor als Softwarelösung
Solche Tools können:
-
Pegel automatisch anpassen
-
Equalizer-Vorschläge machen
-
Kompression optimieren
-
Livestream-Sound separat stabilisieren
Gerade im Livestream-Bereich ist das relevant: Vor Ort wird live gemischt, während der Stream separat kontrolliert wird – teilweise automatisiert.
Die offene Frage blieb: Wie viel Kontrolle geben wir an Algorithmen ab? Und wo braucht es weiterhin das geschulte Ohr?
Ein wiederkehrendes Problem in vielen Gemeinden: Ton funktioniert, Livestream läuft – aber niemand ist für Licht verantwortlich.
Das Ergebnis: Das Gesamtbild wirkt unprofessionell, obwohl einzelne Komponenten gut sind. Jan berichtete vom Einsatz professioneller Lichtsoftware wie GrandMA, die bereits erfolgreich für Lichtprogrammierung genutzt wird.
Die Frage war: Kann KI helfen, Lichtszenarien automatisch an Musik oder Predigtverlauf anzupassen?
Hier steht die Entwicklung noch am Anfang – aber der Gedanke ist klar: KI könnte Personallücken schließen und ein stimmigeres Gesamtbild erzeugen.
Neben Effizienz wurde auch Kreativität thematisiert. Ein Projektbeispiel war der „Multimediale Kreuzweg“ – mit KI-generierten Bildern und Musik.
Hier wurde KI nicht als Optimierungswerkzeug genutzt, sondern als künstlerischer Partner:
-
Bildwelten generieren
-
emotionale Musik erstellen
-
neue ästhetische Zugänge eröffnen
Gerade für kleinere Gemeinden ohne großes Kreativteam kann KI hier einen echten Mehrwert bieten.
Ein überraschender Nebenaspekt der Diskussion: Moderne Medientechnik ist attraktiv für junge Menschen.
Wenn Gemeinde:
-
mit digitalen Tools arbeitet
-
kreative Medienprojekte anbietet
-
KI bewusst integriert
dann entsteht ein Raum, in dem technikaffine Jugendliche gerne mitarbeiten. Technik wird damit nicht nur Dienstleistung – sondern Teil der Gemeindekultur.
Natürlich wurde auch kritisch diskutiert. Einige Rückmeldungen aus Gemeinden sind zurückhaltend oder skeptisch:
-
„Brauchen wir das wirklich?“
-
„Verliert der Gottesdienst an Echtheit?“
-
„Wer kontrolliert die Technik?“
Außerdem bleibt die Frage der Schulung zentral: KI ersetzt kein Know-how. Sie braucht Verständnis.
Die klare Erkenntnis: Automatisierung ohne Ausbildung führt zu Abhängigkeit.
Die zentrale Herausforderung vieler Gemeinden lautet: Wie halten wir Qualität, wenn Ehrenamtliche fehlen?
KI kann helfen:
-
Prozesse zu stabilisieren
-
Wiederholungen zu automatisieren
-
Content effizient weiterzuverarbeiten
-
technische Fehler zu minimieren
Aber sie ersetzt nicht:
-
Teamarbeit
-
Verantwortung
-
geistliche Leitung
Die Session zeigte sehr deutlich: KI in der Medientechnik ist kein futuristisches Experiment. Sie ist ein pragmatisches Werkzeug.
Sie kann:
-
Zeit sparen
-
Qualität steigern
-
Reichweite erhöhen
-
Personallücken abfedern
Aber sie braucht:
-
klare Strategie
-
Schulung
-
bewusste Einbettung in Gemeindekultur
Vielleicht lässt sich die Quintessenz so formulieren:
KI macht keine besseren Gottesdienste.
Aber sie kann helfen, dass weniger Technikstress entsteht –
und mehr Raum für das Wesentliche bleibt.
Kommunikation und Organisation in großen Kirchengemeinden digital gestalten – Lutz Neumeier
Wenn zehn ehemals eigenständige Kirchengemeinden zu einer Großgemeinde fusionieren, verändert sich nicht nur die Struktur – es verändert sich die organisatorische DNA. Genau hier setzte die Session von Lutz Neumeier an. Seit dem 1. Januar arbeitet seine neu entstandene Gemeinde mit zehn Standorten in einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur. Und schnell wurde klar: Ohne konsequente Digitalisierung ist ein solches Konstrukt kaum handhabbar.
In klassischen Gemeindestrukturen funktionieren Papierkalender, Gemeindebrief, Aushang im Schaukasten und informelle Absprachen oft noch erstaunlich lange. Doch sobald mehrere Orte, Gruppen, Gebäude, Haupt- und Ehrenamtliche koordiniert werden müssen, steigt die Komplexität exponentiell.
- Unterschiedliche Kalender.
- Parallele Gruppen.
- Doppelte Raumbelegungen.
- Unklare Zuständigkeiten.
Was früher lokal lösbar war, wird im Verbund schnell unübersichtlich. Lutz formulierte es sinngemäß so: Digitale Organisation ist nicht Modernisierung – sie ist Überlebensstrategie.
Seine jahrzehntelangen Erfahrungen mit digitalen Systemen dokumentiert er auf https://neumedier.de. Dort finden sich auch Vergleiche zwischen ChurchTools, ChurchDesk, Nextcloud, CommuniApp, C-Kalender und weiteren Lösungen.
Nach längerer Nutzung anderer Systeme erfolgte zum 1. Januar der Wechsel zu ChurchTools. Die Entscheidung war kein Schnellschuss, sondern das Ergebnis systematischer Vergleiche.
Der Kalender ist das operative Zentrum. Jeder Standort, jede Gruppe, jedes Projekt hat einen eigenen Kalender – farbcodiert und individuell ein- und ausblendbar. Dazu kommen Ressourcen wie Räume, Fahrzeuge, Technik oder Beamer, die separat buchbar sind.
Besonders betont wurde die feingranulare Rechteverwaltung. Sie ist komplex – aber genau das macht sie leistungsfähig. Es kann exakt gesteuert werden:
-
Wer sieht welchen Kalender?
-
Wer darf Termine eintragen?
-
Wer darf Ressourcen buchen?
-
Wer darf veröffentlichen?
In großen Strukturen ist diese Differenzierung entscheidend, um Chaos zu vermeiden und Verantwortung klar zu definieren.
Ein spannender Teil der Session war die Frage nach Akzeptanz. Technisch funktioniert vieles – aber Menschen zögern. Besonders Ehrenamtliche äußern häufig die Sorge: „Ich möchte nichts kaputt machen.“ Die Lösung war organisatorisch klug: zwei Rollenebenen – „Ehrenamtliche“ und „Ehrenamtliche Plus“. Die Basisrolle erlaubt sichere, eingeschränkte Nutzung. Die Plus-Rolle gibt erweiterten Zugriff. Dadurch entsteht Vertrauen. Niemand wird überfordert, aber engagierte Personen können Verantwortung übernehmen. Dieses Rechtekonzept wirkt nicht nur technisch, sondern psychologisch stabilisierend.
Ein besonders eindrückliches Beispiel war die digitale Anmeldung für eine Jugendfreizeit. Früher: Anmeldezeitraum ca. sechs Wochen.
Jetzt: 11 von 16 Plätzen innerhalb einer Woche vergeben. Die Daten werden automatisch erfasst, können als Excel exportiert und direkt weiterverarbeitet werden. Gleichzeitig sorgt die differenzierte Feld-Sichtbarkeit für datenschutzkonforme Nutzung. Hier wurde Digitalisierung konkret messbar: weniger Verwaltungsaufwand, höhere Geschwindigkeit, bessere Transparenz.
ChurchTools bietet einen integrierten Chat. Gerade für Jugendgruppen wurde dies als große Chance gesehen, WhatsApp zu ersetzen – aus Datenschutzgründen und zur klaren Trennung privater und gemeindlicher Kommunikation. Die App spielt dabei eine zentrale Rolle. Während Weboberflächen teilweise als komplex wahrgenommen werden, ist die mobile App niedrigschwellig und intuitiv. Die Nutzung stieg deutlich schneller über die App als über den Browser.
Erfahrungswert nach fünf Wochen:
-
Jugend: nahezu vollständige Nutzung
-
Vorstand: etwa zwei Drittel aktiv
Ein realistisches Bild: Veränderung braucht Zeit – aber sie ist möglich.
ChurchTools ist modular aufgebaut. In der Praxis lagen die Kosten bei etwa 80 Euro monatlich inklusive Website-Modul. Erweiterungen, Schulungen oder individuelle Anpassungen kommen hinzu. Besonders interessant ist die Möglichkeit, eigene Extensions programmieren zu lassen. Genannt wurde beispielsweise ein automatisierter Kalendereport für Zeitung und digitalen Schaukasten. Für Kirchengemeinden existieren zudem Rahmenverträge – je nachdem, ob nur Mitarbeitende oder alle Gemeindemitglieder integriert werden.
Die größte Hürde ist nicht Technik, sondern Kultur.
Typische Probleme:
-
Unsicherheit beim Eintragen
-
Angst vor Fehlern
-
fehlende Motivation
-
unklare Verantwortlichkeiten
Bewährte Lösungsansätze:
-
gestufte Schulungen
-
klare Rollen
-
Integration in bestehende Kommunikationskanäle
-
Transparenz über den konkreten Nutzen
Digitalisierung funktioniert nicht durch Appelle – sondern durch praktische Erleichterung.
Spannend war der Blick in aktuelle Entwicklungen. In verschiedenen Landeskirchen entstehen neue Initiativen rund um API-basierte Integrationen. WordPress-Plugins ermöglichen direkte Kalendereinbindung. Neue ChurchTools-Extensions erweitern kontinuierlich den Funktionsumfang.
Die Session war daher nicht nur Erfahrungsbericht, sondern auch Zukunftswerkstatt. Mehrere Teilnehmende kündigten vertiefende Austauschrunden an – etwa zu Migration, Kostenmodellen oder Ehrenamtsmanagement.
Predigtvorbereitung mit KI (Textanalyse, Exegese) live ausprobieren – Dirk Bruelheide
Der digitale Schaukasten mit Rasperry PI und KI – Innovation mit 150 Euro Budget – Lutz Neumeiner
Manchmal sind es nicht die großen Plattformstrategien oder komplexen KI-Agenten, die eine Gemeinde sichtbar machen. Manchmal reicht ein Raspberry Pi, ein Monitor im Schaufenster – und eine kluge Idee.
Die Session zum digitalen Schaukasten war ein Paradebeispiel dafür, wie pragmatische Digitalisierung aussehen kann: niedrigschwellig, kostengünstig, robust – und zugleich strategisch durchdacht.
Viele Gemeinden kennen das Problem: Der klassische Schaukasten vor dem Gemeindehaus ist da – aber er wird unregelmäßig gepflegt. Plakate hängen zu lange, sind verwittert, wirken statisch. Gleichzeitig produzieren Gemeinden inzwischen digitale Inhalte, die online funktionieren – aber nicht zwingend im Straßenbild.
Die Frage lautete daher: Wie kann man Inhalte flexibel, aktuell und attraktiv im öffentlichen Raum präsentieren – ohne großes Budget?
Die Antwort war ebenso einfach wie wirkungsvoll: Ein digitaler Schaukasten auf Basis eines Raspberry Pi 4 (ca. 50 €) und eines handelsüblichen 27″-Monitors (ca. 100 €). Gesamtkosten: rund 150 Euro.
Der Aufbau ist bewusst minimalistisch:
- Raspberry Pi 4 als Steuerzentrale
- 27″-Monitor im Fenster platziert
- Mechanische Zeitschaltuhr, die das System morgens hoch- und abends herunterfährt
- Webbasierte Anzeige von Plakaten
Das System läuft seit 2017 stabil. Und wenn es doch einmal abstürzt? Dann wird es schlicht neu gestartet.
Diese Nüchternheit war ein zentrales Learning der Session: Digitalisierung muss nicht perfekt sein – sie muss funktionieren.
Die Hardware ist nur die halbe Geschichte. Der entscheidende Schritt war die Entwicklung einer eigenen, social-media-ähnlichen Upload-Plattform für Plakate.
Die Idee: Ehrenamtliche sollen ohne technische Hürden Bilder hochladen können – ähnlich wie bei Instagram.
Die letzten vier Plakate werden automatisch angezeigt – sowohl im Schaukasten als auch auf der Website.
Die Umsetzung wurde mithilfe von ChatGPT realisiert. Lutz beschrieb, wie er dem System erklärte, was er haben möchte – und innerhalb von zwei bis drei Tagen entstand eine funktionierende Lösung.
Die Plattform ist öffentlich einsehbar unter:
Die letzten vier Plakate erscheinen beispielsweise automatisch auf:
Hier wird deutlich: KI wurde nicht als Inhaltsersteller genutzt, sondern als Entwicklungspartner für eine technische Lösung.
Ein überraschend strategischer Punkt war die Formatwahl. Das gewählte Format 4:5 hat mehrere Vorteile:
- passt gut ins Schaufenster
- funktioniert auf Social Media
- eignet sich für Gemeindebrief
- lässt sich mit 150 dpi im Format 2160×2700 drucken
Demnächst sollen die Plakate automatisch ins 4:5-Format gebracht werden – ebenfalls automatisiert.
Hier wird deutlich: Digitalisierung bedeutet nicht nur Technik, sondern Gestaltungslogik.
Ein Format, das überall funktioniert, spart Aufwand und verhindert Medienbrüche.
Der digitale Schaukasten steht nicht isoliert. Er ist eingebettet in:
- ChurchTools-Kalender
- Website-Integration
- Social-Media-Kanäle
- WhatsApp Business (über Meta Business Manager)
Das Prinzip dahinter: Nicht jedes Medium muss alles können. Aber sie müssen miteinander sprechen.
Der Schaukasten ist der analoge Anker. Die Website ist die digitale Vertiefung. Social Media ist die Reichweitenverlängerung.
Warum funktioniert das so gut?
Mehrere Gründe wurden in der Diskussion deutlich:
1. Bewegung erzeugt Aufmerksamkeit
Wechselnde Bilder ziehen Blicke an. Ein leuchtender Bildschirm im Fenster wirkt anders als ein statisches Plakat.
2. Niedrige Einstiegshürde für Ehrenamtliche
Weil das Hochladen so einfach ist, machen Ehrenamtliche gerne mit. Technische Komplexität wäre hier ein Killerkriterium gewesen.
3. Kontinuität statt Kampagnen
Das System läuft dauerhaft. Es braucht keine Projektphase, keine Sonderfinanzierung, kein Relaunch.
4. Resilienz
Selbst bei einem Ausfall ist die Lösung robust. Kein Servercluster, kein Cloud-Overkill.lt“
Ein bemerkenswerter Satz fiel in der Session:
„Ich gehe dahin, wo die Leute sind.“
Der digitale Schaukasten ist genau das. Er ist nicht nur Technikspielerei, sondern eine bewusste Entscheidung für Präsenz im Alltag der Menschen.
Während viele Diskussionen um digitale Kirche sich auf Social Media konzentrieren, zeigt dieses Projekt eine andere Perspektive:
Nicht nur online Reichweite gewinnen – sondern den öffentlichen Raum neu denken.k
Interessant war auch die klare Haltung zum Gemeindebrief: „Nur über meine Leiche wird der aufgegeben.“
Der digitale Schaukasten ersetzt Print nicht. Er ergänzt ihn. Print bleibt wichtig. Digital erweitert die Dynamik.
Diese Haltung war bezeichnend für die gesamte Session: Keine Technik-Euphorie, sondern pragmatische Ergänzung.
Die große Stärke dieses Projekts ist seine Skalierbarkeit.
Jede Gemeinde könnte:
- einen Raspberry Pi einsetzen
- einen günstigen Monitor verwenden
- eine einfache Weblösung aufsetzen
- Ehrenamtliche schulen
Die Hürde ist nicht finanziell – sie ist mental.
Der digitale Schaukasten zeigt, dass Innovation nicht teuer sein muss.
Mit 150 Euro entsteht:
- höhere Sichtbarkeit
- aktuelle Kommunikation
- einfache Beteiligung
- mediale Brücke zwischen analog und digital
Und vielleicht ist genau das das stärkste Signal dieser Session: Digitalisierung beginnt nicht mit Strategiepapieren. Sie beginnt mit einer Idee – und dem Mut, sie einfach umzusetzen.
Wie können wir KI nutzen, um als Gemeinde/Kirche aus dem Kreisen um uns selbst rauszukommen? – Dr. Jörg Dechert
Jörg Dechert stellte eine unbequeme Frage:
Kreisen wir als Kirche zu sehr um uns selbst – und wenn ja, kann KI uns helfen, das zu erkennen und zu verändern?
Es ging nicht um Tools im engeren Sinne. Es ging um Denkweisen. Um Haltungen. Und um die Fähigkeit, uns selbst von außen zu betrachten.
1. Das Phänomen: Kirche kreist um sich selbst
Die Session begann mit einer offenen Sammlung von Symptomen. Die Teilnehmenden nannten:
-
Binnensprache, die Außenstehende nicht verstehen
-
Gesprächsgruppen, die sich immer wieder aus denselben Personen bilden
-
Über Menschen reden statt mit ihnen
-
Bestehendes um jeden Preis bewahren
-
Angst vor Veränderung
Diese Beobachtungen waren kein Vorwurf – sondern eine realistische Bestandsaufnahme. Gerade gewachsene Gemeinden entwickeln eigene Sprachcodes, unausgesprochene Erwartungen, implizite Normen. Wer neu dazukommt, spürt das sofort – auch wenn niemand es ausspricht.
Und genau hier setzte die KI-Perspektive an.
2. Die eigentliche Frage: Wie sehen wir aus – von außen?
Selbstreferenzialität entsteht nicht aus böser Absicht. Sie entsteht aus Gewohnheit. Wer über Jahre miteinander unterwegs ist, entwickelt:
-
vertraute Begriffe
-
geteilte Erlebnisse
-
implizite Theologie
-
kulturelle Muster
Das Problem: Man merkt es selbst nicht mehr. Die Kernidee der Session war daher:
KI kann als Spiegel dienen – als externer Blick auf unsere Sprache, unsere Kommunikation, unsere Programme.
Nicht als moralische Instanz. Sondern als analytisches Werkzeug.
3. Der „Kanaanäisch-Filter“ – Sprache überprüfen lassen
Ein besonders einprägsamer Begriff war der humorvoll gemeinte „Kanaanäisch-Filter“. Gemeint ist: Kirchliche Insider-Sprache wird für Außenstehende oft unverständlich.
Beispiele:
-
„Wir laden euch herzlich zum Lobpreisabend ein.“
-
„Wir feiern das Abendmahl.“
-
„Wir wollen im Glauben wachsen.“
Für Eingeweihte klar. Für Außenstehende: erklärungsbedürftig.
Mit KI lässt sich prüfen:
-
Wie verständlich ist ein Text für Menschen ohne kirchlichen Hintergrund?
-
Welche Begriffe sind erklärungsbedürftig?
-
Wie würde man denselben Inhalt für eine bestimmte Zielgruppe formulieren?
Hier kann KI helfen, alternative Sprachvarianten zu entwickeln – etwa für:
-
junge Erwachsene
-
Familien mit wenig kirchlicher Sozialisation
-
Menschen mit säkularer Prägung
Wichtig dabei: Die KI entscheidet nicht, was wahr ist. Sie hilft nur, Verständlichkeit zu prüfen.
4. Programme, Websites und Abläufe überprüfen lassen
Ein weiteres Feld war die Analyse bestehender Programme.
KI kann:
-
Gottesdienstabläufe durchgehen und auf Klarheit prüfen
-
Webseiten analysieren (z. B. „Gibt es klare Call-to-Actions?“)
-
Veranstaltungstexte bewerten
-
Zielgruppenansprache simulieren
Beispielhafte Fragen:
-
„Würde ein Außenstehender verstehen, was hier passiert?“
-
„Was fehlt an Informationen?“
-
„Welche impliziten Annahmen werden getroffen?“
Gerade bei Websites wird oft sichtbar:
-
Viel Information für Insider
-
Wenig Orientierung für Suchende
KI kann hier Muster erkennen, die man selbst überliest.
5. Liedtexte, Liturgie und kulturelle Selbstverständlichkeiten
Ein besonders sensibler Bereich war die Verstehbarkeit von Liedtexten. Viele klassische Kirchenlieder sind theologisch tief – aber sprachlich weit entfernt vom Alltag heutiger Menschen.
KI kann:
-
Sprachliche Verständlichkeit prüfen
-
alternative Formulierungen vorschlagen
-
Kernbotschaften extrahieren
Dabei geht es nicht um inhaltliche Veränderung, sondern um Bewusstmachung: Welche Bilder sprechen wir? Welche Metaphern sind noch anschlussfähig?
6. Social Listening – Was bewegt Menschen wirklich?
Ein weiteres Instrument ist sogenanntes Social Listening. KI kann analysieren:
-
Welche Themen werden aktuell häufig diskutiert?
-
Welche Fragen stellen Menschen in Foren oder sozialen Netzwerken?
-
Welche Sorgen dominieren öffentliche Debatten?
Die Idee dahinter: Nicht nur aus der eigenen Gemeinde-Perspektive planen – sondern gesellschaftliche Bewegungen wahrnehmen.
Allerdings wurde auch gewarnt: KI-Daten sind nie neutral. Sie spiegeln die Quellen, aus denen sie gespeist werden. Verzerrungen sind möglich.
7. Blinde Flecken identifizieren
Ein besonders wertvoller Ansatz war die Frage:
„Wo sind unsere blinden Flecken?“
Man kann KI gezielt fragen:
-
Welche Gruppen sprechen wir vermutlich nicht an?
-
Welche Perspektiven fehlen in unserer Kommunikation?
-
Welche Annahmen sind implizit?
Das ersetzt keine echte Begegnung mit Menschen außerhalb der Kirche – aber es kann Denkanstöße geben.
8. Die Grenzen: Haltung ersetzt kein Tool
Ein entscheidender Punkt der Session war die Klarstellung: KI kann Denkstrukturen sichtbar machen. Aber sie kann keine Haltung erzeugen. Selbstreferenzialität ist kein technisches Problem. Sie ist ein kulturelles. Wer Veränderung vermeiden will, wird auch mit KI Wege finden, sich selbst zu bestätigen.
Darum wurde immer wieder betont:
-
Offenheit ist Voraussetzung
-
Veränderungsbereitschaft ist nötig
-
Die Perspektive „Reich Gottes“ muss größer sein als die eigene Gemeinde
9. Kirche als lernende Organisation
Die Diskussion berührte auch tieferliegende Denkmuster:
-
Kirche als Halt und Anker – deshalb soll alles bleiben, wie es war
-
Angst vor „negativem Einfluss“ von außen
-
Abgrenzung statt Dialog
Hier kann KI nur Impulsgeber sein.
Die eigentliche Arbeit geschieht:
-
im Gespräch
-
im Gebet
-
in echter Begegnung
Aber KI kann helfen, schneller zu erkennen, wo Denkweisen starr geworden sind.
10. Strategische Bedeutung für die Zukunft
In einer Zeit, in der:
-
Sprachmodelle Google ersetzen
-
Suchende digital prüfen
-
Kommunikation zunehmend algorithmisch vermittelt wird
wird Selbstreferenzialität riskanter. Wer nur für sich selbst spricht, wird nicht gefunden.
KI kann hier zu einem Instrument der strategischen Selbstreflexion werden:
-
Wie erscheinen wir im digitalen Raum?
-
Welche Narrative vermitteln wir?
-
Sind wir anschlussfähig?
Fazit: Spiegel statt Steuerung
Die vielleicht treffendste Zusammenfassung der Session lautet:
KI ist kein Heilsbringer.
Aber sie ist ein Spiegel.Und wer bereit ist, hineinzuschauen,
kann blinde Flecken erkennen.Kirche wird nicht durch Tools missionarischer.
Aber sie kann durch kluge Analyse verständlicher werden.Und vielleicht beginnt geistliche Erneuerung manchmal genau dort –
wo wir bereit sind, uns selbst neu anzusehen.
Kirche im Social Web: Einblicke in die Fedikirche auf Mastodon – Thomas Ebinger, Alexander Müller, Jörg Sorge
Während viele kirchliche Social-Media-Strategien noch stark auf Instagram, Facebook oder TikTok ausgerichtet sind, stellte diese Session eine bewusst andere Perspektive vor: Kirche im Fediverse – dezentral, datensensibel, barrierebewusst und werteorientiert.
Die Session wurde von Alexander Müller, Jörg Sorge und Thomas Ebinger gestaltet. Ihr Anliegen war nicht, kommerzielle Plattformen pauschal zu verteufeln, sondern eine realistische Alternative sichtbar zu machen – und zugleich zu fragen: Welche digitalen Räume passen zu unserem Selbstverständnis als Kirche?
Das Fediverse ist kein einzelnes Netzwerk, sondern ein Zusammenschluss vieler dezentraler Plattformen, die technisch miteinander kommunizieren. Bekanntestes Beispiel: Mastodon. Statt eines zentralen Unternehmens (wie bei Meta oder X) gibt es viele unabhängige Server, sogenannte „Instanzen“, die miteinander föderiert sind.
Kirchliche Akteure nutzen unter anderem:
Das bedeutet: Wer sich auf einer dieser Instanzen registriert, kann mit Nutzerinnen und Nutzern anderer Instanzen kommunizieren – ohne einem globalen Konzern zu gehören.
Der Unterschied liegt im Prinzip:
- Dezentralität statt Plattform-Monopol.
- Community-Regeln statt algorithmischer Gewinnmaximierung.
- Dialog statt Reichweiten-Manipulation.
Ein konkretes Projekt ist die FediKirche (https://fedikirche.de/). Sie versteht sich nicht als einzelne Gemeinde, sondern als Netzwerk kirchlicher Akteure im Fediverse.
Beispiele für Formate:
-
#Morgengebet (https://kirche.social/@morgengebet)
-
FediKirche am Montag
-
Fedilicht – eine digitale Kerze entzünden (https://fedilicht.de)
Diese Formate zeigen: Kirche im Fediverse ist nicht primär Marketing, sondern geistliche Praxis im digitalen Raum. Ein zentrales Element ist zudem die sogenannte FediWall – eine kuratierte Anzeige von Beiträgen bestimmter Accounts oder Hashtags, etwa:
Damit lassen sich kirchliche Aktivitäten sichtbar bündeln – z. B. für Websites oder Projektseiten.
Ein besonders interessanter Diskussionspunkt war die Organic Reach Rate (ORR) – also die tatsächliche Sichtbarkeit von Beiträgen. Im Fediverse gibt es keinen zentralen, intransparenten Algorithmus, der Beiträge nach Werbewert priorisiert. Das führt häufig dazu, dass Beiträge tatsächlich bei den Followern ankommen – ohne künstliche Drosselung.
Das bedeutet:
-
Weniger Reichweiten-Optimierungsdruck
-
Weniger „Content-Hacks“
-
Mehr Dialog
Allerdings wurde auch klar gesagt: Die absolute Reichweite ist geringer als bei Instagram oder TikTok. Wer 50.000 Jugendliche erreichen möchte, wird das im Fediverse aktuell nicht tun.
Ein wesentliches Motiv vieler kirchlicher Akteure ist der Respekt vor digitaler Privatsphäre.
Beispiel: Das evangelische Kirchspiel Probstzella nutzt Mastodon bewusst als datensensible Alternative zu kommerziellen Plattformen. Beiträge sind auch ohne eigenen Account lesbar. Menschen können teilnehmen, ohne sich in einem werbefinanzierten System zu bewegen.
Hinzu kommt ein starkes Engagement für digitale Barrierefreiheit:
-
Alt-Texte für Bilder sind Standard
-
Screenreader-Kompatibilität wird ernst genommen
-
Text steht vor Effekthascherei
Das passt bemerkenswert gut zu kirchlichen Grundhaltungen: Inklusion, Zugänglichkeit, Transparenz.
Die Diskussion blieb bewusst ehrlich.
Typische Nutzergruppen im Fediverse:
-
Technikaffine Menschen („Nerd-Ecke“)
-
Künstler:innen
-
politisch engagierte Menschen
-
oft eher männlich geprägt
Nicht automatisch kirchenfreundlich – eher diskursiv, teilweise kontrovers.
Auch die Frage nach politischer Moderation kam auf: Da jede Instanz eigene Regeln hat, hängt die Diskussionskultur stark vom jeweiligen Server ab.
Eine zentrale Frage lautete:
Wenn unsere Zielgruppe auf Instagram und TikTok ist – lohnt sich dann das Fediverse?
Die Antwort war differenziert:
-
Wer Menschen erreichen will, die bewusst kommerzielle Plattformen meiden, findet hier einen Raum.
-
Wer ausschließlich Reichweite maximieren möchte, braucht weiterhin Instagram & Co.
-
Eine Parallelstrategie ist sinnvoll: Werteorientierte Präsenz im Fediverse, Reichweitenarbeit auf kommerziellen Plattformen.
Als TikTok-Alternative wurde beispielsweise Loops genannt:
Aus der Session lassen sich mehrere strategische Impulse ableiten:
1. Digitale Räume sind theologische Räume
Die Wahl der Plattform ist nicht neutral.
Wer sich für das Fediverse entscheidet, setzt ein Zeichen für Dezentralität, Transparenz und Datenschutz.
2. Reichweite ist nicht der einzige Erfolgsindikator
Wichtiger als „Views“ kann sein:
-
Qualität der Gespräche
-
Nachhaltige Beziehungen
-
Vertrauensaufbau
3. Kirche passt strukturell gut ins Fediverse
Das föderierte Modell ähnelt kirchlichen Strukturen: Viele selbstständige Einheiten, die verbunden sind. Dezentrale Vielfalt ist kein Problem – sondern Systemprinzip.
Für Gemeinden oder Einzelpersonen wurde ein klarer Startpunkt genannt:
-
Account erstellen bei
https://kirche.social/explore -
Starterpacks & FediWall auf
https://fedikirche.de -
Tipps & Tricks von Thomas Ebinger:
https://thomas-ebinger.de/2022/11/meine-mastodon-tipps-und-tricks/
https://thomas-ebinger.de/2025/01/meine-pixelfed-tipps-und-tricks/
„Kirche im Fediverse“ ist kein Ersatz für Instagram.
Es ist eine bewusste Ergänzung.
In einer Zeit, in der Plattformen zunehmend algorithmisch und kommerziell getrieben sind, entsteht hier ein Raum, der stärker von Gemeinschaft, Transparenz und Respekt geprägt ist.
Das Fediverse ist kleiner. Langsamer. Weniger laut. Aber vielleicht ist genau das seine Stärke.
Und vielleicht ist genau das die Frage, die hinter dieser Session stand:
Wollen wir nur Reichweite –
oder wollen wir Reichweite mit Werten?
Gott spielen in Virtual Reality – Dr. Karsten Kopjar
Dr. Karsten Kopjar hat in seiner Session keinen Technikvortrag gehalten, sondern ein Experiment eröffnet: Was passiert, wenn wir „Gott spielen“ – nicht als Gotteslästerung, sondern als bewusstes Gedankenspiel – und dabei spüren, wie sich Macht, Verantwortung und Weltgestaltung anfühlen? Der Titel war bewusst provokant. Gleich zu Beginn hat Karsten die Leitplanke gesetzt: Es geht nicht um eine theologische Behauptung („Wir können Gott ersetzen“), sondern um eine Reflexionsfläche. Virtual Reality ist dabei nicht nur Medium, sondern ein Verstärker: Weil sie immersiv ist, wird aus einem Gedanken schneller ein Erlebnis.
Karsten stellte sich und seine Arbeit vor: Er hat bereits viele Stationen hinter sich und ist gerade auf dem Weg, Pfarrer zu werden. Parallel ist er mit GeistRaum aktiv – einem Format bzw. einem Raumkonzept (u. a. beim CVJM Erfurt) mit mehreren VR-Brillen, in dem VR-Erfahrungen nicht isoliert konsumiert, sondern gemeinschaftlich reflektiert werden. Genau diese Kombination – Erlebnis plus Gespräch – wurde zur didaktischen Grundlage der Session.
Dann kam die Kernfrage: „Kann man Gott spielen – und ist das böse?“ Karstens Antwort war differenziert: Die Gefahr liegt nicht im Spiel an sich, sondern darin, wie unreflektiert wir mit Immersion umgehen. Deshalb die klare Bitte an die Teilnehmenden: Feedback geben, wenn technische Probleme auftreten oder wenn die Demo zu lang wird – ein kleiner Satz, aber sinnbildlich für das Thema: Wer in VR führt, trägt Verantwortung für das Erleben der anderen.
Im Zentrum stand eine Live-Demo des VR-Spiels DeiSim (https://www.deisim.com). Karsten führte die Runde durch verschiedene Speicherstände, um Entwicklung über Zeit zu zeigen: vom ersten Aufbau (Wiese, erste Menschen, Wald) bis hin zu späteren Zivilisationsphasen.
Das Spielprinzip ist simpel – und gerade deshalb theologisch aufgeladen: Man erschafft eine Welt mit Regeln, beobachtet Menschen, und hat dann Möglichkeiten, einzugreifen.
Konkrete Elemente, die gezeigt und diskutiert wurden:
-
Welt erschaffen: Landschaft, Wald, erste Siedlungen
-
Menschen mit Eigenschaften: Menschen sind nicht nur NPCs, sondern haben Charakterzüge, die ihr Verhalten beeinflussen
-
Wunder werden freigeschaltet: Eingriffe sind an Fortschritt gekoppelt
-
Indikator für „Wohlergehen“: In der Mitte gibt es eine Anzeige, wie gut es den Menschen insgesamt geht
-
Moralische Eingriffe: Als „Gott“ kann man drastische Dinge tun (z. B. einen „Ketzer töten“) – oder alternative Wege wählen (z. B. Wunder, Gottesbegegnungen)
Spätere Speicherstände zeigten Eskalation: Zivilisationen können Krieg gegeneinander führen, und der „Gott-Spieler“ kann Partei ergreifen, unterstützen, lenken, beruhigen – oder den Konflikt laufen lassen. Auch Religion ist als Mechanik präsent: Durch die „Sendung eines Priesters“ kann man Glauben stabilisieren oder wieder stärken, wenn er bedroht ist.
Was an dieser Stelle spürbar wurde: VR und Spielmechanik erzeugen ein Gefühl von Handlungsmacht. Und genau damit entstehen sofort die Fragen, die man sonst abstrakt diskutieren würde – jetzt aber aus dem Erleben heraus:
-
Greife ich ein oder lasse ich laufen?
-
Was ist „gut“ – kurzfristig oder langfristig?
-
Darf ich Gewalt nutzen, um Ordnung herzustellen?
-
Ist ein Wunder Manipulation, Trost oder pädagogischer Impuls?
Nach der Demo war die Session ausdrücklich auf Austausch angelegt. Es ging nicht nur um „Wie funktioniert das Spiel?“, sondern darum, was es in uns triggert.
Es gab drei Arten von Diskussion:
-
Impressionen: „Was geht dir durch den Kopf?“
Viele waren sichtbar beeindruckt – nicht nur vom technischen Eindruck, sondern von der unmittelbaren Verantwortung, die man spürt, wenn man Entscheidungen trifft. -
Mechanische Fragen:
Wie werden Wunder freigeschaltet? Wie reagieren Menschen? Welche Freiheitsgrade habe ich überhaupt? Wo setzt das Spiel Grenzen – und was sagt das über das Gottesbild, das im Spiel steckt? -
„Gott ins Spiel bringen“ – und in andere Games übertragen
Karsten öffnete den Horizont: Die Frage nach Gott und Weltgestaltung lässt sich auch in anderen Spielen stellen. Der Punkt ist nicht DeiSim allein, sondern die didaktische Möglichkeit, über Spiele Fragen zu stellen, die sonst schwer zugänglich sind.
Sehr wichtig war Karstens Beschreibung der Vor- und Nachbereitung. GeistRaum arbeitet mit einem Konzept, das VR entdramatisiert und zugleich vertieft:
-
Vorbereitung: einfache Spiele, um den Umgang mit der VR-Brille zu üben (damit die Technik nicht die Erfahrung dominiert)
-
„Apfelpausen“: Zwischendurch bewusst unterbrechen, Apfel essen, reden, reflektieren
Das klingt banal, ist aber pädagogisch klug: Es bricht die Immersion, holt Menschen zurück in den Körper, und öffnet Raum für Sprache. -
Gemeinschaftliche Reflexion: Obwohl DeiSim ein Single-Player-Spiel ist (Karsten nannte das humorvoll „monotheistisch“), wird es im GeistRaum-Setting gemeinschaftlich verarbeitet: Was hast du getan? Warum? Was hat es mit dir gemacht?
Und genau hier kam der zentrale Transfer:
„Wie gehe ich mit dem Ketzer um?“ – das ist im Spiel eine Option. Aber die Reflexion fragt: Wie gehen wir im realen Leben mit Menschen um, die anders denken? Was sagt das über Macht aus? Über Angst? Über missionarischen Eifer? Über Freiheit?
Damit wird VR zur Ethik- und Theologie-Werkstatt.
Die Session blieb nicht bei DeiSim. Karsten gab Hinweise, wie VR/AR im Religionsunterricht oder in kirchlicher Bildungsarbeit genutzt werden kann.
Genannt wurden u. a.:
-
GeistRaum: https://geistraum.online/
-
ZfdC Freiburg – Material/Ideen mit VR-Filter: https://zfdc.ph-freiburg.de/suchergebnisse/?_sfm_fachbezug=Religion
-
Weitere Spiel-/Projektideen:
-
Nutzung von Minecraft in religiöser Bildung
-
Oddie und die Suche nach der Quelle (kooperatives Spiel; eine VR-Brille, mehrere Smartphones; als APK per Sideload installierbar)
-
(historischer Hinweis: „Plank Experience“ gegen Höhenangst, inzwischen aus dem Shop entfernt)
-
Als Zukunftsidee wurde genannt, biblische Geschichten – etwa den Weg nach Emmaus – mit Godot XR nachzubauen. Das ist technisch anspruchsvoller (Programmierkenntnisse nötig), aber didaktisch reizvoll, weil man Inhalte aktiv gestalten kann.
Karsten Kopjar hat VR nicht als Techniktrend verkauft, sondern als Erfahrungsraum, in dem sich Glaubensfragen verdichten:
-
VR macht Entscheidungen spürbar, nicht nur diskutierbar.
-
Spiele liefern Modelle – und Modelle zeigen, welches Gottesbild, Menschenbild und Weltbild mitschwingt.
-
Der eigentliche Mehrwert entsteht erst durch die Reflexion: „Warum habe ich so gehandelt?“
-
Kirche hat damit ein neues Werkzeug, um Ethik, Macht, Verantwortung, Freiheit und Gottesbilder in Lernprozessen zu öffnen – besonders dort, wo reine Sprache oft nicht mehr trägt.
Welche Leitplanken braucht christliche Digitalisierung im Familienkontext – Robin Zimmermann
Die Session von Robin Zimmermann gehörte zu den existenziellsten Gesprächen des Barcamps. Während andere Sessions über Technik, Reichweite oder Organisation sprachen, ging es hier um etwas Grundsätzliches: Wie kann Digitalisierung in Familien so gestaltet werden, dass sie Glauben stärkt – und nicht verdrängt?
Im Zentrum stand die Entwicklung einer Familien-App („Feed Your Family“), die Eltern dabei unterstützen soll, Glaubensinhalte in den Alltag zu integrieren. Doch sehr schnell wurde klar: Es geht nicht nur um eine App. Es geht um ein Spannungsfeld, das viele Familien erleben.
1. Die Ausgangslage: Digitale Realität trifft Glaubenspraxis
Robin bringt eine besondere Perspektive mit: Er arbeitet unter anderem beim Seehaus e. V. mit straffällig gewordenen Jugendlichen und ist zugleich Projektleiter im Bereich christlicher Medienarbeit.
Ein zentrales Thema seiner Arbeit ist der deutliche Anstieg digitaler Straftaten bei Jugendlichen. Diese Realität verschärft die Sensibilität für Medienkompetenz, Datenschutz und Schutzmechanismen.
Gleichzeitig gibt es eine andere Beobachtung: Viele Eltern sehnen sich danach, Glauben im Familienalltag aktiver zu leben. Nicht nur sonntags im Gottesdienst. Nicht nur im Kindergottesdienst. Sondern zuhause.
Zwischen diesen beiden Polen – digitaler Gefahrenraum und geistliche Sehnsucht – entsteht die Kernfrage:
Wie kann Digitalisierung in Familien so eingesetzt werden, dass sie verbindet statt isoliert?
2. Die Kernidee: Die App als Moderationstool – nicht als Kinderunterhaltung
Ein entscheidender Punkt der Diskussion war die Zielgruppe. Die App richtet sich primär an Eltern, nicht an Kinder.
Eltern sind die „digitalen Familienmanager“. Sie organisieren Termine, Einkauf, Schule – meist über das Smartphone. Warum also nicht auch geistliche Impulse?
Wichtig dabei:
- Jüngere Kinder sollen keinen eigenen Zugang zur App haben.
- Der Bildschirm ist Anleitung, nicht Spielplattform.
- Die App soll Gespräche initiieren – nicht ersetzen.
Das Ziel ist keine Gamification von Glauben, kein „Bibelleseduell“, keine Streak-Logik. Sondern: strukturierte Impulse für echte Familienzeit.
3. Digitale Abstinenz vs. sinnvolle Integration
Ein offenes Spannungsfeld der Session war die provokante Frage:
Warum eine App, wenn wir Kinder eigentlich vom Handy fernhalten wollen?
Die Antworten waren differenziert.
Einerseits gibt es eine wachsende Bewegung digitaler Abstinenz. Eltern erleben:
- Kinder greifen sofort zum Handy, wenn Eltern es nutzen.
- Bildschirmzeit ist ohnehin hoch.
Andererseits organisieren Eltern ihr Leben längst digital. Eine App kann daher:
- helfen, geistliche Rituale zu etablieren
- Impulse vorbereiten
- Struktur schaffen
Das Smartphone wird hier nicht zum Konsumgerät für Kinder, sondern zum Vorbereitungstool für Eltern.
Ein konkretes Szenario: Eltern öffnen die App, erhalten einen Gesprächsimpuls, drucken ihn aus – und führen die Andacht analog am Tisch durch. Digital dient dem Analogen.
4. Datensparsamkeit als Grundprinzip
Ein zentrales Leitmotiv war das Prinzip der Datensparsamkeit. Gerade im Familienkontext ist Vertrauen entscheidend. Deshalb wurden klare Empfehlungen formuliert:
- Keine Geburtsdaten erfassen
- Stattdessen Altersklassen nutzen
- Transparenz über gespeicherte Daten schaffen
- Gesetzliche Vorgaben strikt beachten
Diskutiert wurde auch, ob Features wie Geburtstagsideen sinnvoll sind. Hier wurde bewusst abgewogen: Mehr Funktionalität bedeutet oft mehr Datenerhebung – und damit höhere Hemmschwellen.
Die klare Tendenz: Weniger Daten schaffen mehr Vertrauen.
5. Didaktische Ansätze – Theologie mit Kindern
Die App soll nicht frontal belehren, sondern partizipativ arbeiten. Genannt wurden unter anderem:
- Audio-Impulse mit Gesprächsaufträgen
- Haptische Aufgaben (schreiben, suchen, gestalten)
- Methoden der Kinder- und Jugendtheologie
- Verbindung von gemeinsamer Familienzeit und individueller Vertiefung
Die Leitfrage lautet: Wie kann Glauben dialogisch erlebt werden?
Die App soll nicht „unterhalten“, sondern Gesprächsprozesse ermöglichen.
6. Qualitätssicherung als Vertrauensfaktor
Ein starker Gedanke der Session war die Rolle der Qualität.
Viele Eltern fühlen sich überfordert:
- Zeitmangel
- Unsicherheit bei theologischen Fragen
- Angst, „nicht genug zu wissen“
Hier kann eine kuratierte, qualitativ geprüfte App unterstützen.
Im Unterschied zu frei generierten KI-Inhalten bietet sie:
- theologisch geprüfte Inhalte
- klare Struktur
- verlässliche Impulse
Qualität wird damit zum strategischen Argument.
7. Marktumfeld und Differenzierung
Die Diskussion zeigte, dass es zwar viele Familien-Apps gibt – aber kaum vergleichbare Angebote im christlichen Kontext.
Säkulare Apps fokussieren auf:
- Terminplanung
- Organisation
- Familienmanagement
Christliche Apps für Jugendliche (z. B. YouVersion) arbeiten mit:
- Bibelleseplänen
- Community
- Gamification
Kinder-Apps setzen stärker auf Interaktion mit Geschichten.
Was bislang fehlt, ist: Eine App, die Eltern als geistliche Leiter ihrer Familie stärkt – ohne die Kinder digital zu überfluten.
8. Medienkompetenz – explizit oder implizit?
Ein weiterer Diskussionspunkt war, ob Medienkompetenz explizit Teil der App sein sollte.
Argumente dagegen:
- Fokusverlust
- Überfrachtung
Argumente dafür:
- Eltern brauchen Orientierung
- Vertrauen entsteht durch Transparenz
Der Konsens tendierte zu einer impliziten Integration:
Medienkompetenz wird nicht als eigener Kurs eingebaut, sondern fließt in UX und Inhalte ein.
9. Empirische Grundlage – Familien als Schlüssel
Ein wichtiger strategischer Gedanke war die empirische Bedeutung religiöser Sozialisation in Familien.
Studien zeigen: Familien sind entscheidender als Programme.
Daraus entsteht eine klare Marketing-Speerspitze: Der Bedarf an strukturierter Glaubenspraxis zuhause ist hoch.
Wenn digitale Tools hier unterstützen, erfüllen sie eine echte Lücke.
10. Offene Fragen und nächste Schritte
Mehrere Spannungsfelder bleiben:
- Ab welchem Alter ist eigenständige Nutzung sinnvoll?
- Wie segmentiert man Zielgruppen präzise?
- Wie bleibt man datensparsam und funktional zugleich?
- Wie gestaltet man UX so, dass Werte sichtbar werden?
Test-User werden gesucht – das Projekt ist bewusst iterativ angelegt.
Fazit: Digitalisierung als dienendes Instrument
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der Session war diese: Digitale Tools sind weder Feind noch Heilsbringer. Sie sind Instrumente.
Wenn sie:
- moderierend
- datensparsam
- altersgerecht
- dialogfördernd
eingesetzt werden, können sie Familien stärken.
Das Ziel ist nicht mehr Bildschirmzeit. Sondern bessere Familienzeit.