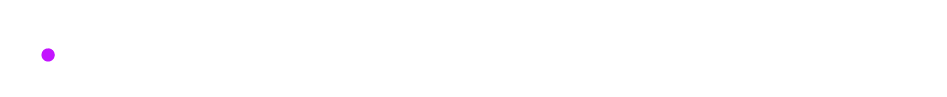Einführung und Vorstellung
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und technologischer Wandel sind in aller Munde und sollten längst Teil des Alltags von Unternehmen, Organisationen und Gemeinden sein. Doch auf dem Weg von der Theorie zur Praxis gibt es noch viele offene Fragen – deshalb sind wir heute hier. Mein Name ist Jan Knauf, ich gehöre zum Leitungsteam von GOTTDIGITAL und begleite euch durch den Abend.
Unsere Experten:
- Joachim Stängle, GOTTDIGITAL e.V., Gründer und Inhaber von Stängle Consulting
- Dr. Jörg Dechert, GOTTDIGITAL e.V., Geschäftsführer der sinnkubator gGmbH
Was ist der digitale Werdegang der Experten und was fasziniert sie an Digital Change?
Joachim Stängle:
Ich bin eigentlich kein Techniker. Viele denken bei Digitalisierung sofort an Technik, aber ich kann nicht programmieren. Ich weiß aber bei vielem, wie es funktioniert. Mein Einstieg in die digitale Welt begann mit der Gründung der CINA im Jahr 1996. Damals haben wir viel ausprobiert, experimentiert und eine richtige Startup-Kultur gelebt, auch wenn wir das damals noch nicht so genannt haben. Das hat mich geprägt. Heute bin ich mit meinem eigenen Unternehmen unterwegs, mit dem Schwerpunkt auf Kultur und Mindset. Es geht mir darum, Menschen zu befähigen, mit den Veränderungen durch Digitalisierung, digitale Transformation und jetzt auch KI umzugehen. Mich fasziniert besonders, welche Möglichkeiten sich für Gemeinden und das Reich Gottes ergeben, wenn es um Arbeitserleichterungen oder Tools geht, die Dinge einfacher machen. Und ich finde es spannend, wie sich die Rolle von Technik und Digitalisierung in der Gemeindearbeit immer wieder verändert und neue Chancen eröffnet.
Jörg Dechert:
Ich ergänze das gerne. Ich kann programmieren, zumindest noch ein bisschen, früher mehr. Ich war schon immer ein Tüftler und habe als Kind alles auseinandergeschraubt, um zu verstehen, wie es funktioniert. Das hat sich durch mein Physikstudium und die Promotion gezogen. Nach dem Studium bin ich bei der CINA eingestiegen, wo Joachim und ich auch gemeinsam gearbeitet haben. Danach war ich 25 Jahre beim ERF, in verschiedenen Rollen, zuletzt als Vorstand. In den letzten zehn Jahren habe ich dort viel an digitalem Wandel und Organisationsveränderung mitgestaltet. Auch jetzt, in meiner neuen Rolle bei sinnkubator, schätze ich den hands-on-Ansatz: einfach ausprobieren, lernen, experimentieren. Gerade bei KI finde ich es spannend, wie man durch Ausprobieren und exploratives Lernen schnell Fortschritte machen kann. Das begeistert mich bis heute an diesem Themenspektrum. Ich glaube, dass wir in Deutschland oft zu sehr auf Theorie und Planung setzen, statt einfach mal zu machen und zu schauen, was passiert. Digitalisierung und KI bieten die Chance, genau das zu tun: ausprobieren, Fehler machen, daraus lernen und gemeinsam weiterkommen.
Wie entstand das Format der digitalen Podiumsdiskussion?
Jörg Dechert:
Wir sind beide alt genug, um uns noch an Domian zu erinnern, eine Call-In-Sendung aus den 90ern. Die Idee war: Es gibt so viele Fragen rund um Digitalisierung und KI, warum nicht ein ähnliches Format machen, in dem wir live auf die Fragen der Teilnehmenden eingehen? Uns ist wichtig, Wissen zu teilen und gemeinsam zu lernen. Das ist Teil unserer digitalen Kultur bei GOTTDIGITAL: Wir geben gerne weiter, was wir selbst erfahren und gelernt haben, und laden andere ein, sich mit ihren Fragen einzubringen.
Joachim Stängle:
Wir haben schon immer gerne neue Formate ausprobiert und dabei auch ein bisschen Humor und Kreativität eingebracht. Aber es gibt auch einen fachlichen Hintergrund: Wir haben viel erlebt und sind nah an den Themen dran. Dieses Wissen wollen wir teilen, weil wir glauben, dass es für viele hilfreich sein kann. Und so ist die Idee für diese digitale Call-In-Show entstanden.
Wie kann echte Gemeinschaft digital gelingen?
Joachim Stängle:
Echte Gemeinschaft im digitalen Raum hängt davon ab, ob Menschen das wollen und können. Es ist wichtig, sich zu fragen: Was will ich eigentlich erreichen? Geht es darum, sich regelmäßig zu treffen, gemeinsam zu beten, oder geht es um Beziehungsaufbau über große Distanzen, vielleicht sogar mit Menschen, die man nie persönlich trifft? Vertrauen muss wachsen, und das braucht Zeit – wie im echten Leben auch. Die richtigen Tools sind entscheidend: Ob Zoom-Calls, digitale Whiteboards sie muss nicht genauso sein wie analoge Gemeinschaft. Wichtig ist, dass wir uns fragen: Wozu machen wir das? Was wollen wir erreichen? Und dann die passenden Tools und Formate wählen.
Welche kirchlichen Schmerzverstärker erschweren den Wandel – und wie überwinden wir sie?
Jörg Dechert:
Veränderung ist für alle Menschen herausfordernd, egal ob in Kirche, Behörde oder Unternehmen. Es gibt immer Menschen, die begeistert sind, und andere, die skeptisch bleiben. In kirchlichen Organisationen kommen aber noch besondere Schmerzverstärker dazu. Ein Beispiel ist die Tendenz, Veränderungen zu theologisieren: Plötzlich wird aus einer organisatorischen Frage eine Glaubensfrage gemacht. Dann heißt es etwa: „Wir müssen erst alles prüfen, bevor wir etwas Neues wagen.“ Oder es wird argumentiert, dass das Neue sich erst beweisen muss, bevor es akzeptiert wird. Das macht Wandel besonders schwer. Ein weiterer Punkt ist die starke Fürsorge: In Kirchen will man oft niemandem etwas zumuten, alle sollen mitgenommen werden. Das führt dazu, dass Veränderungen sehr langsam und vorsichtig angegangen werden. Aber Wandel ist immer auch Zumutung. Wenn man versucht, jedem Einzelnen alles recht zu machen, kommt man nicht voran.
Joachim Stängle:
Ich möchte ergänzen, dass es in kirchlichen Strukturen oft auch an Transparenz und Vernetzung fehlt. Die Organisationen sind häufig in Abteilungen und Bereiche aufgeteilt, die wenig miteinander zu tun haben. Das erschwert Zusammenarbeit und führt zu Doppelstrukturen. Gerade in großen Landeskirchen ist das ein echtes Problem. Wandel in Richtung mehr Vernetzung und projektbezogener Zusammenarbeit ist schwierig, wenn die Strukturen so starr sind. Außerdem gibt es oft persönliche Verflechtungen: Man arbeitet beruflich zusammen und trifft sich dann abends noch im Hauskreis oder am Sonntag im Gottesdienst. Das kann den Veränderungsdruck zusätzlich erhöhen und macht es emotional schwieriger.
Wie kann man den unvermeidlichen Schmerz von Veränderung begleiten, ohne ihn zu beschönigen?
Jörg Dechert:
Die Antwort steckt schon in der Frage: Es geht darum, zu begleiten, ohne zu beschönigen. Begleiten heißt, die Menschen nicht allein zu lassen, sondern als Leitung oder Verantwortliche selbst mit im Prozess zu sein. Es reicht nicht, von außen Veränderungen zu verordnen und dann zu erwarten, dass alle mitziehen. Man muss selbst Teil des Prozesses sein, ansprechbar bleiben, Fragen zulassen und auch Unsicherheiten eingestehen. Gleichzeitig darf man den Schmerz nicht kleinreden. Veränderung ist anstrengend, es gibt Verluste, und nicht alles wird sofort besser. Es ist wichtig, ehrlich zu sein und keine falschen Versprechungen zu machen. Manchmal wird es erst einmal chaotischer, bevor es besser wird. Menschen wollen als Erwachsene behandelt werden, auch in Kirche. Sie können mit Klarheit und Ehrlichkeit umgehen, wenn sie merken, dass sie nicht allein gelassen werden.
Joachim Stängle:
Ich finde es wichtig, dass man zwar alle mitnehmen will, aber nicht diejenigen, die nicht wollen oder nicht können, das Tempo bestimmen lässt. Es ist gut, Angebote zu machen, Schulungen und Unterstützung zu bieten, aber die Veränderung darf nicht ausgebremst werden, weil einzelne nicht mitziehen. Gerade in ehrenamtlichen Strukturen ist das eine Herausforderung. Es braucht eine Balance zwischen Rücksichtnahme und dem Mut, auch mal voranzugehen.
Wie kann man Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Zielgruppen aktiv einbinden und digital stärken?
Joachim Stängle:
Die Frage ist sehr allgemein, weil es darauf ankommt, um wen es konkret geht: Angestellte, Ehrenamtliche, bestimmte Zielgruppen? Grundsätzlich ist Wertschätzung der Schlüssel. Wenn ich Menschen einbinden will, muss ich ihnen zeigen, dass ihre Meinung und ihr Beitrag wichtig sind. Oft wird gesagt: „Das geht bei uns nicht.“ Besser wäre zu fragen: „Wie könnte es bei uns gehen?“ Das gilt für Präsenz wie für digitale Formate. Digitale Stärkung kann ganz praktisch aussehen: Ermutigungen per Messenger, digitale Tools für Zusammenarbeit, regelmäßige Schulungen. Viele Menschen haben nicht von klein auf mit digitalen Medien gearbeitet. Sie brauchen Unterstützung, um sich sicher zu fühlen. Es geht darum, Kompetenzen aufzubauen, Angebote zu machen und die Menschen mitzunehmen – aber auch zu akzeptieren, dass nicht alle alles mitmachen werden.
Wie und wo kann man Best Practice und Empfehlungen für digitale Tools in Gemeinden teilen?
Jörg Dechert:
Die beste Anlaufstelle ist GOTTDIGITAL selbst! 🙂 Es gibt einen Newsletter, eine Facebook-Gruppe, einen Blog und eine neue Webseite. Dort findet ihr Tool-Listen, Erfahrungsberichte und fast alle Vorträge der letzten Jahre als Video. Alles ist kostenlos zugänglich. Wer möchte, kann die Arbeit auch finanziell unterstützen. Wir engagieren uns hier, weil wir überzeugt sind, dass der Austausch von Erfahrungen und Wissen der beste Weg ist, um gemeinsam weiterzukommen.
Wie kann KI konkret helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren?
Jörg Dechert:
KI ist kein klassisches Prozessoptimierungstool. Prozesse sind festgelegte Abläufe, die möglichst effizient gestaltet werden sollen. KI kann an vielen Stellen unterstützen, zum Beispiel beim Brainstorming, bei der Strukturierung von Ideen oder beim Erstellen von Texten und Grafiken. In der Konzeptionsphase kann KI helfen, schneller zu Ergebnissen zu kommen. Auch bei der Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Tools kann KI unterstützen, indem sie Daten analysiert, umstrukturiert und aufbereitet. Generative KI, wie sie heute oft genutzt wird, kann Texte, Bilder oder Videos erstellen, die für Social Media, Gemeindebriefe oder Veranstaltungen verwendet werden können. Das spart Zeit und Ressourcen, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit, Prozesse vorher klar zu strukturieren.
Joachim Stängle:
Man könnte zu jedem dieser Anwendungsfelder eigene Abende füllen: KI in der Gemeinde, bei der Predigtvorbereitung, bei der Videoerstellung oder in der persönlichen Organisation.. Wenn man diese einfach digitalisiert, entstehen chaotische Software-Lösungen, die niemand mehr durchblickt. Besser ist es, sich vorher zu überlegen: Wie soll der Prozess idealerweise ablaufen? Dann kann man ein passendes Tool auswählen und die Abläufe darauf abstimmen. Das spart Zeit, Geld und Nerven.
Jörg Dechert:
Gerade in kleineren Teams oder Gemeinden ist vieles nie schriftlich festgehalten worden. Die Abläufe haben sich einfach entwickelt, je nachdem, wer gerade da war. Das Know-how steckt in den Köpfen der Leute, aber nicht auf Papier. Digitalisierung bietet die Chance, gemeinsam auszuprobieren, was besser funktioniert. Wichtig ist, dass man sich irgendwann auf ein Tool einigt und dann die Prozesse daran anpasst – nicht umgekehrt. In größeren Organisationen braucht es mehr Strategie und Planung, aber auch dort gilt: Erst die Prozesse klären, dann digitalisieren.
Wie kann man Menschen mitnehmen, die bei Digitalisierung und KI noch ganz am Anfang stehen?
Jörg Dechert:
Es ist wichtig, Verständnis und Geduld zu zeigen. Nicht jeder ist sofort begeistert von neuen Technologien. Manche haben Berührungsängste oder fühlen sich überfordert. Hier hilft es, niedrigschwellige Angebote zu machen, Schulungen anzubieten und die Menschen Schritt für Schritt mitzunehmen. Es geht nicht darum, alle auf einmal auf denselben Stand zu bringen, sondern individuelle Wege zu ermöglichen. Erfolgserlebnisse sind wichtig: Wenn jemand merkt, dass er mit einem digitalen Tool eine Aufgabe schneller oder besser erledigen kann, wächst das Vertrauen. Wichtig ist auch, die Vorteile klar zu kommunizieren und zu zeigen, wie Digitalisierung und KI den Alltag erleichtern können.
Joachim Stängle:
Man sollte die Menschen dort abholen, wo sie stehen, und ihnen Zeit geben, sich an Neues zu gewöhnen. Es ist hilfreich, Vorbilder und Multiplikatoren zu haben, die andere mitziehen. Gleichzeitig darf man nicht erwarten, dass alle alles mitmachen. Es braucht Geduld, Wertschätzung und die Bereitschaft, immer wieder neu zu erklären und zu unterstützen.
Was sind eure wichtigsten Learnings und Empfehlungen für den digitalen Wandel?
Jörg Dechert:
Mein wichtigstes Learning ist: Einfach machen! Nicht zu lange planen, sondern ausprobieren, Erfahrungen sammeln und daraus lernen. Digitalisierung und KI bieten viele Chancen, aber sie erfordern auch Mut, Neues zu wagen und Fehler zuzulassen. Offenheit, Experimentierfreude und die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, sind entscheidend. Und: Niemand muss den Weg allein gehen. Der Austausch mit anderen, das Teilen von Erfahrungen und das gemeinsame Lernen sind der Schlüssel zum Erfolg.
Joachim Stängle:
Für mich ist entscheidend, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Technik ist ein Werkzeug, kein Selbstzweck. Es geht darum, Menschen zu befähigen, zu unterstützen und gemeinsam neue Wege zu gehen. Wertschätzung, Geduld und die Bereitschaft, immer wieder neu anzufangen, sind für mich die wichtigsten Faktoren für gelingenden digitalen Wandel.
Wie geht es weiter und wie können sich die Teilnehmenden weiter einbringen?
Jan Knauf:
Vielen Dank an alle, die heute dabei waren, Fragen gestellt und mitdiskutiert haben. Die Diskussion geht weiter – auf der Webseite von GOTTDIGITAL, in der Facebook-Gruppe, im Newsletter und bei kommenden Veranstaltungen. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und weitere Fragen. Gemeinsam gestalten wir den digitalen Wandel – in Kirche, Gemeinde und Gesellschaft.